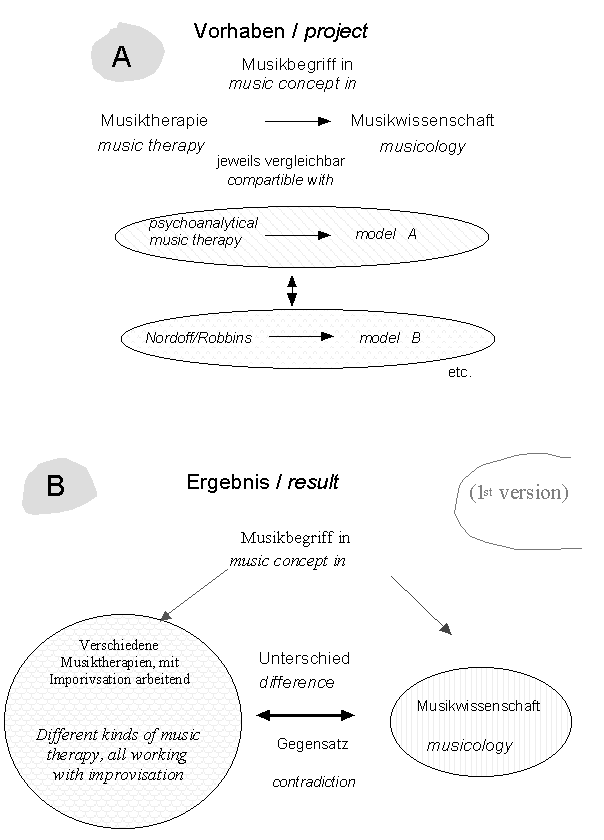
ZUM MUSIKBEGRIFF DER MUSIKTHERAPEUTISCHEN IMPROVISATION
Rosemarie Tüpker
Summary:
This paper examines the (implicit) concept of music that we advocate when we practise and teach therapeutic improvisation. To this end, various music concepts stemming from musicology, music education and music therapy are compared. In a social critical section on the concept of human capital and of the utility of people, the paper discusses the affirmative or critical potential of various music concepts.In conclusion, the study confronts the narrow musicological concept of music in terms of the musical opus with a concept in terms of musical improvisation, which brings music into focus as direct communication between people. When they learn improvisation in music therapy, the students encounter music as a way of structuring relationships between people and as sharing feelings and the experience of oneself and the world. They experience music as a process and event, as an expression and reflection of inner states, as a medium of knowledge. In music therapy, they come to know music as a medium in which life experience can be reflected, as a medium which can draw them as therapists into the other person’s experience, as a medium with a potential for reformation and transformation which can make a transforming internalisation in the sense of a healing transformation possible.
Zusammenfassung: Zu diesem Vortrag wurde untersucht, welchen (impliziten) Musikbegriff wir mit der musiktherapeutischen Improvisation und ihrer Lehre vertreten. Verglichen werden dazu verschiedene Musikbegriffe aus Musikwissenschaft, Musikpädagogik und Musiktherapie. Mit einem gesellschaftskritischen Exkurs über das Konzept des Humankapitals und der Verwertbarkeit von Menschen wird nach dem affirmativen oder kritischen Potential des jeweiligen Musikbegriffs gefragt.
Als Ergebnis der Untersuchung wird dem verengten Werkbegriff der Musikwissenschaft ein Musikbegriff der musikalischen Improvisation gegenüber gestellt, der Musik als direkte Kommunikation zwischen Menschen in den Mittelpunkt rückt. Im Improvisationsunterricht in der Musiktherapie lernen die Studierenden Musik als Beziehungsgestaltung zwischen Menschen und als Mit-Teilung von Empfindung und Selbst- und Welterleben kennen. Sie erfahren Musik als Prozess und Ereignis, als Ausdruck und Reflexion seelischer Verhältnisse, als Erkenntnismittel. In der Musiktherapie lernen sie Musik kennen als ein Medium, in dem sich Lebenserfahrung widerspiegeln kann, welches sie als TherapeutInnen in das Erleben des anderen hineinziehen und durch die Möglichkeit der Neu- und Umgestaltung eine umwandelnde Verinnerlichung im Sinne einer heilsamen Verwandlung ermöglichen kann.
Keywords: improvisation, music therapy, affirmative and critical music concept, musicology, human capital
Während wir alle unmittelbar ein gemaltes Bild von einem gesungenen Lied, einen gesprochenen Text von einem erklingenden Musikstück unterscheiden können, ist die Frage danach, was wir unter Musik verstehen - will man es in Worte fassen - durchaus nicht einfach zu beantworten. Was ist Musik? Lässt sich das überhaupt so fragen? Als was verstehen wir Musik? Was fassen wir als Musik auf? Als was legen wir Musik aus? Und wie kommen wir darauf? Auf welchen Musikbegriff berufen wir uns, wenn wir sagen: „Das ist doch keine Musik mehr!" oder „Das ist Musik in meinen Ohren."
Die Frage nach dem Musikbegriff ist dabei durchaus keine rein akademische Frage, sondern reicht weit hinein in den kulturellen Umgang mit Musik. Der Musikbegriff bestimmt, wen Musik erreicht, wem was zugänglich und verfügbar ist. Das können wir uns leicht an dem Phänomen des Ausgrenzens der „Unmusikalischen" vergegenwärtigen. Die Frage danach, wie wir Musik begreifen, ist auch keine rein nachträgliche Frage, sondern eine die immer schon maß-gebend beteiligt ist, wenn wir komponieren, üben, unterrichten, Werke gemäß historischer Aufführungspraxis aufführen oder nach neuerem Gusto, und wenn wir mit Musik behandeln. Nachträglich ist höchstens die Reflexion über den impliziten Musikbegriff, mit dem wir so oder so immer schon umgehen. Dass eine solche Reflexion notwendig ist, gerade auch für die Musiktherapie und noch einmal mehr für uns als Lehrende, wollte ich mit diesem Vortrag aufzeigen.
Ein erster Fragekomplex, den ich hier nur anschneiden und zur Diskussion stellen kann, ohne ihm weiter nachzugehen, bezieht sich auf die Gemeinsamkeiten und Differenzierungen der Auffassungen von Musik innerhalb der Musiktherapie. Welchen Musikbegriff vertritt eigentlich die Musiktherapie? Gibt es einen Musikbegriff des Improvisierens? Oder unterscheiden sich die verschiedenen musiktherapeutischen Richtungen im Hinblick auf unterschiedliche Auffassungen von Musik? Könnten evt. verschiedene Musikbegriffe der Musiktherapien verglichen werden mit bestimmten historisch anzutreffenden Auffassungen von Musik? Gibt es Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den in Musikwissenschaft und Musikpädagogik üblichen Musikbegriffen? Wie prägen sie den Umgang mit der Musik in der Behandlung und in der Lehre?
Daran knüpft sich ergänzend die Frage an, welchen Musikbegriff wir in den verschiedenen Schulen und Ausbildungen im Improvisationsunterricht lehren, sei es nun explizit, unbemerkt oder „heimlich". Ist es ein affirmativer Musikbegriff, der bestehende Verhältnisse bestätigt und (ver-)festigt oder ist es ein „kritischer" Musikbegriff? Was bedeuten die Kategorien einer kritischen Ästhetik für die Praxis und Lehre der musiktherapeutischen Improvisation? Lassen sich diese Kategorien der kritischen Theorie (Adorno) anwenden auf die Frage, inwieweit die Art, wie wir das musikalische Improvisieren als Lehrende der Musiktherapie vermitteln, eher eine Affirmation, ein Gleitmittel für bestehende kulturell-gesellschaftlichen Verhältnisse ist, auf dass sie noch etwas besser in unveränderter Form funktionieren? Oder stellen wir uns quer? Inwieweit ist unser Musikbegriff in der Musiktherapie, in der Improvisation etwas Neues? Impliziert er eine kritische Haltung? Hat er ein kritisches Potential? Setzt er zu kritisierenden Tendenzen der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung etwas entgegen? Footnote 01
In bezug auf den ersten Fragekomplex erlebte ich bei der kursorischen Lektüre die Überraschung, dass mir die Differenz zwischen dem Musikverständnis der meisten MusiktherapeutInnen und dem in der Musikwissenschaft Üblichen wesentlich mehr ins Auge sprang, als dass es möglich war, Parallelen zwischen jeweils vergleichbaren Verständnissen in den verschiedenen musiktherapeutischen Schulen und in der Musikwissenschaft und -geschichte vorzufinden.
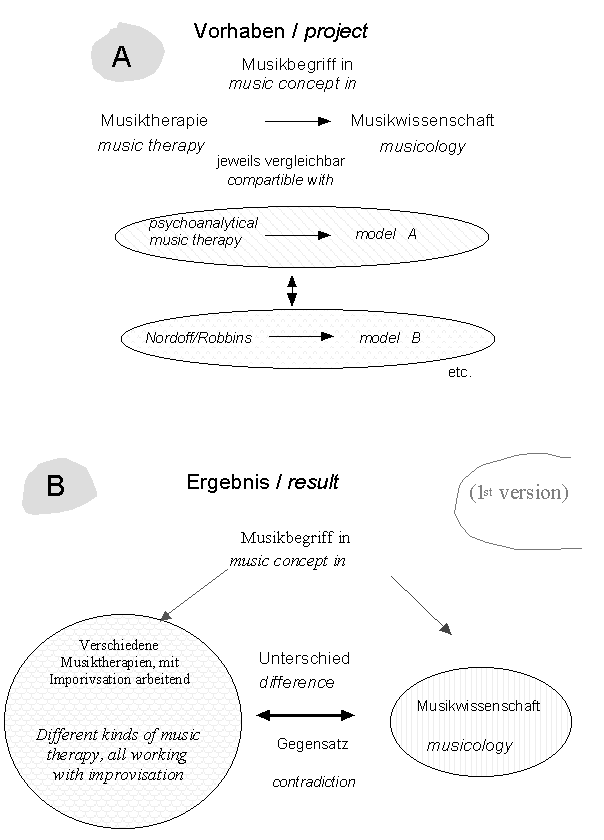
Nun ist dieser Eindruck vermutlich kein endgültiger und es würde sicher durchaus Sinn machen, noch einmal mehr zu lesen - vor allem auch musikwissenschaftliche Texte - und vielleicht käme dann doch einiges zu dem heraus, was Sie hier in der Skizze A angedeutet sehen. Ich muss zugeben, dass mir dazu dann die rechte Lust fehlte und es mir wesentlich interessanter schien, in nicht ganz so geordneter Form das herauszustellen, was sich mir als eine grundsätzliche Differenz (Skizze B) aufdrängte, da an den hier herausgestellten Gegensätzlichkeiten die Musiktherapie als ein Bereich des Musiklebens erkennbar wird, welcher auch im Hinblick auf übergreifende Fragen eine eigene Sichtweise beizutragen hat, die über den Behandlungskontext hinaus auch kulturell-gesellschaftliche Bedeutung hat.
Beispiele zum herkömmlichen Musikbegriff
Den in der Musikwissenschaft vorherrschenden - und meiner Erfahrung nach auch in der Musikausbildung weitgehend vertretenen Musikbegriff - möchte ich nun an drei Beispielen aufzeigen. Es handelt sich dabei durchaus um keine exotischen Beispiele. Sie stellen vielmehr das ganz normale musikwissenschaftliche Denken dar (zumindest trifft dies auf die deutsche Musikwissenschaft zu) und sind mir relativ zufällig - auf der Suche nach Texten zum Musikbegriff - begegnet.
Musicology
Music communication and its effects
No idea that music communication could be something other than listening to music.
And music therapy? No more than sitting at the CD-player – with what effects?
On the objective cognition of music
"Verbal music reception" = what people have written about musical opus.
"Objective knowledge = if different authors have written the same things
Teaching an instrument to adults
high-quality motives low-quality motives to play an instrument
- those which are directed - looking for the meaning of life
to music as such
-
better understanding of - looking for social contactmusical structures
"The history of music is nothing other than history of the striving to give more and more spirit to the structured world of tones" (Arnold Schering)
People for music or music for people?
Beispiel 1:
Casimir, Torsten (1991): Musikkommunikation und ihre Wirkung. Eine systemtheoretische Kritik. Footnote 02
Sowohl vom Titel als auch vom Untertitel her erschien die neuere Dissertation Torsten Casimirs der Schwerpunktsetzung der Musiktherapie nahe liegend. Verblüffend war dann zunächst die Auffassung bezüglich dessen, was hier unter musikalischer Kommunikation verstanden wird. Vieles ließe sich erwarten: die Kommunikation zwischen den Musikern beim Proben, Aufführen oder privatem Musizieren, in Abgrenzung dazu die vermutlich andersartige Kommunikation beim Improvisieren - in verschiedenen Stilen und Zusammenhängen, vielleicht die Kommunikationsformen im Instrumentalunterricht, vielleicht eine Kritik bezüglich der Entfremdung in der Kommunikation zwischen Aufführenden und Publikum, Komponisten und Interpreten etc. Doch nichts von alledem kommt überhaupt in den Blick.
Trotz kritischer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kommunikation allgemein (vor allem nach Luhmann) folgt die Arbeit in ihrem Verlauf der unausgesprochenen Einschränkung, dass unter Musikkommunikation das Rezipieren (Hören) von komponierter und aufgeführter, bzw. über Medien vermittelter Musik verstanden wird. Das geschieht unversehens – ohne weitere Definition, Erklärung oder Begründung. Es ist keine reflektierte Auswahl, sondern man merkt, dass der Autor - und man muss vermuten auch die Betreuer der Arbeit - gar nicht auf die Idee gekommen sind, dass der Inbegriff musikalischer Kommunikation nicht gerade darin besteht, dass da einer an seinem CD-Player sitzt und sich ein Stück anhört - gespielt vor längerer Zeit an einem anderen Ort - gedacht, gefühlt und aufgeschrieben von einem Menschen, der zumeist längst schon verstorben ist. Es ist einfach (fast) nie die Rede von etwas anderem.
Das macht sich dann auch an einer Stelle bemerkbar, wo es um Musiktherapie geht (ebendort S. 273-284). Musiktherapie wird hier dargestellt als „ein Fallbeispiel" für das Thema „Psychische Folgen von Musikkommunikation". Es folgt eine Darlegung einiger älterer Musiktherapietexte, die einer Auswahl folgt, durch die der begrenzte Begriff musikalischer Kommunikation nicht in Frage gestellt wird. Auch hier scheint der Autor überhaupt nicht zu bemerken, dass in der Musiktherapie meist eine ganz andere Art von Kommunikation geschieht als das Nachvollziehen eines anderenorts längst abgeschlossenen Prozesses. Nein, auch im Fallbeispiel Musiktherapie macht er sich lediglich - ziemlich spekulative - Gedanken zu den anzunehmenden „Wirkungen" des Musikhörens und bezeichnet dies als „Musikkommunikation".
Beispiel 2:
Wolf, Rainer (1986): Zur objektiven Erkenntnis von Musik. Footnote 03
Dass Musik eine Kulturerscheinung ist, somit ein Phänomen im Bereich des Menschlichen, scheint mir unter MusiktherapeutInnen weitgehend selbstverständlicher Konsens zu sein. Wir wissen um die Subjektivität des Musikerlebens und haben zugleich erfahren, dass es darüber hinaus auch intersubjektive Gemeinsamkeiten im Erleben und in der Auffassung von Musik gibt. Einige von uns nehmen an, dass diese Gemeinsamkeiten kulturgebunden sind, andere vermuten daneben Archetypisches - jenseits der subjektiven und kulturellen Erfahrung. Und auch wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass für diese intersubjektive Übereinstimmung gerne fälschlicherweise der Begriff des Objektiven gebraucht wird, erscheint uns ein Titel wie der der „objektiven Erkenntnis von Musik" doch eher etwas rätselhaft - oder aus einer anderen Zeit stammend. Oder man würde vielleicht eine kritische Reflexion über die Illusion objektiver Erkenntnis gerade im Zusammenhang mit Musik erwarten.
Letzteres findet sich in der Dissertation von Rainer Wolf am allerwenigsten. Hier wird tatsächlich „bewiesen", dass und wie „objektive Erkenntnis von Musik" möglich ist. Etwas vereinfacht (und zugegebenermaßen etwas ironisch zugespitzt) ist eine solche für den Autor des Werkes schlicht dann gegeben, wenn die verschiedenen Autoren, die über ein bestimmtes Stück mal irgendwas geschrieben haben, alle in etwa dasselbe geschrieben haben.
In Kurzfassung geht dieser Beweis so: Mit einer schier unglaublichen Verdrehung unternimmt es der Autor zunächst, die erkenntnistheoretische Position Kants (mit den Kategorien a priori) mit Hilfe von Konrad Lorenz auszuhebeln: Da wir (Menschen) mit diesen Verstandeskategorien (Raum, Zeit, Kausalität) die Evolution überlebt haben, müssen diese nun der „objektiven Welt" (im Sinne von Außenwelt im Gegensatz zu den Verstandeskategorien) angehören.Footnote 04 Auf diese Art jede auch nur annähernd konstruktivistische oder erkenntniskritische Bescheidenheit aushebelnd, (wobei der Konstruktivismus und andere erkenntnistheoretische Positionen nach Kant vorsichtshalber unerwähnt bleiben) kommt Wolf in großem Schwung dahin, dass der Mensch somit also doch zur objektiven Erkenntnis der Wirklichkeit in der Lage ist. Und daraus ergibt sich für ihn folgerichtig, dass auch die „verbale Musikrezeption" objektiv ist - und zwar dann, wenn die Autoren in der Darstellung übereinstimmen.
Was um Himmels willen, fragte ich mich an dieser Stelle, ist „verbale Musikrezeption"? Das scheint dem Autor wiederum etwas so Selbstverständliches zu sein, dass er nur in einem kleinen Nebensatz der Einleitung darüber Auskunft erteilt: Es ist die „sich im Schrifttum unterschiedlichster Art niederschlagende Rezeption eines Komponisten." (ebendort, S. 1) Wenn Sie also ein Stück hören und dann etwas dazu veröffentlichen, dann ist das „verbale Musikrezeption" - noch dazu die „Rezeption des Komponisten".
Worauf das Ganze hinaus soll? Das versteht man, wenn man die Unanfechtbarkeit dessen, was dann folgt, nämlich eine ganz normale Debatte über Gustav Mahler in Auseinandersetzung mit Adorno, endgültig besiegelt findet mit den Worten: „Dem vorangegangenen Kapitel fiel vor allem die Aufgabe zu, über diejenigen naturwissenschaftlich begründbaren und somit weitgehend zweifelsfreien erkenntnistheoretischen Voraussetzungen (Prämissen) Auskunft zu geben, die zu der hier vertretenen Auffassung führten, ... „ (ebendort S. 39 Footnote 05, Hervorhebung RT) Mit anderen Worten: Anstelle erkenntniskritischer Reflexion geht es allein um den (unglücklichen Footnote 06) Versuch, die eigene Auffassung so durchzusetzen, dass jede abweichende Auffassung und Kritik unterbunden werden soll.
Warum das für uns dennoch von gewissem Interesse ist? Das, worüber wir uns hier wundern, was uns vielleicht skurril oder als extreme Ausnahme erscheint, ist innerhalb der Musikwissenschaft eine ganz normale Dissertation, über deren Inhalt und Gestus sich kaum ein Musikwissenschaftler weiter verwundern wird. Insofern wird m. E. eben in dem Fremdheitsgefühl, welches vermutlich die meisten MusiktherapeutInnen bei einer solchen Arbeit überfällt, die Andersartigkeit eines Musikbegriffes spürbar, der sich in der Musiktherapie durch den anderen Umgang mit Musik herausgebildet hat, ohne dass wir dies vielleicht selbst als etwas Besonderes erlebt haben.
Beispiel 3:
Klöckner, D. (1989): Instrumentalunterricht für Erwachsene Footnote 07
Als letztes möchte ich ein Beispiel dafür geben, welche Auswirkungen diese so selbstverständliche Auffassung von Musik hat, deren Wesen quasi jenseits der psychologisch-menschlichen Kategorien angenommen wird.
Musizieren wird von Klöckner als eine Tätigkeit beschrieben, deren Sinn „in der Wirkung auf die ‘eigene Natur’ des Menschen" liegt (ebendort S.104). Da vermutet man zunächst eine gewisse Verwandtschaft zu unserem Musikbegriff.
Zur Frage nach den Beweggründen des Musizierens Erwachsener wird aber dann unterschieden zwischen den quasi wahren und den eher niederen: „Hierbei spielen dann neben direkt auf die Musik, die praktische Beschäftigung mit ihr und das bessere Verstehen von musikalischen Zusammenhängen ausgerichteten Wünschen auch solche Gründe eine Rolle, bei denen die Musik mehr als Medium zur Verwirklichung anderer Bedürfnisse gesehen wird (S. 104, Hervorhebung RT):
(Nicht wahr, man erwartet jetzt irgendwie etwas Unanständiges
oder Ehrenrühriges, eine Art Musikmissbrauch. Stattdessen kommt aber: )
„Suche nach Sinnerfüllung des eigenen Lebens und vor allem die Suche nach sozialen Kontakten." (ebendort)
(Für uns wäre es das doch:
Ein sinnerfülltes Leben im sozialen Kontakt mit anderen.
Das hat im Musikbegriff der Musiktherapie offensichtlich
eine völlig andere Konnotation als hier.)
Ergänzt werden muss an dieser Stelle, dass dieser Autor durchaus einen uns nahestehenden Impetus hat, der dem Musizieren erwachsener Laien einen persönlichkeitsfördernden Wert zumisst. Hier zeigt sich eher gerade im Kontrast zum gewollten Impetus die Wirksamkeit eines Musikbegriffs, der zwischen „der Musik" als dem „Eigentlichen" und dem doch irgendwie anrüchigem „Sonstigen" unterscheidet, wie dies weitgehend unbemerkt unsere gesamte Musikpädagogik, insbesondere auch die Instrumentalausbildung durchzieht. In der Ausbildung zur Musik hin ist nicht primär die Musik für die Kinder da, sondern die Kinder werden für die Musik selektiert, zurechtgestutzt, hergerichtet oder, wenn sie ein bestimmtes Ideal nicht mehr erfüllen, als unbrauchbar verworfen. Die Frage einer solchen Musikpädagogik lautet nicht: braucht dieses Kind die Musik, sondern: kann die Musik dieses Kind gebrauchen. (Im kleineren Maßstab z.B. Es fehlt noch eine Bratsche, dieses Kind kann gut hören, also wird den Eltern gesagt: „Bratsche wäre das richtige Instrument für ihr Kind." Zwanzig Jahre später erzählt das ehemalige Kind, dass es immer schon lieber Klavier lernen wollte.)
Eine wie ich finde entlarvende Formulierung dieses Musikbegriffs formulierte Arnold Schering: „Die Geschichte der Musik ist nichts anderes als die Geschichte des Strebens, der gestalteten Tonwelt immer stärkere Geistigkeit" einzugeben. Hier gibt es eine Welt, die - wie die platonische Ideenwelt - außerhalb des Menschen existiert und die von den Menschen bedient werden muss, denen sich die menschlichen Interessen (die damit zugleich zu niederen Interessen degradiert werden) unterzuordnen haben. Aus diesem Geist heraus sind wir es z.B. in der klassischen Musikausbildung gewohnt, die (in der Bewertung edleren) Interessen, die sich auf „die Musik" „als solche" ausrichten, hervorzuheben und uns der angeblich „außermusikalischen" Interessen (wie Sinnsuche, soziales Miteinander, bildhaftes Erleben oder gar sinnliche Erfahrungen beim Musizieren ) zu schämen. Den Niederschlag dieser musikalischen Sozialisation finden wir in vielen Facetten bei unseren Studierenden.
In einer ersten Version möchte ich nun die Differenz zwischen diesem herkömmlichen Musikbegriff der Musik(-wissenschaft) und dem der Musiktherapie mit folgender Skizze verdeutlichen:
Im Mittelpunkt des herkömmlichen Musikbegriff steht das (autonome) Werk, welches als komponiertes, aufgeführtes und rezipiertes analysiert, eingeordnet, erkannt oder verfehlt wird. Hingegen sehen wir in der Musiktherapie Musik als ein Geschehen an, welches sich zwischen Menschen (im engeren Sinne zwischen PatientIn und TherapeutIn) ereignet. Die nachfolgende Skizze versucht einige spezifischere Ausprägungen beider Bereiche aufzuzeigen, auf die ich später zurückkommen werde.


Das lässt sich auch noch einmal psychologisch formulieren: Der einseitig ausgeprägte Werkbegriff in der Musik birgt die Gefahr, Musik zu verdinglichen. Sie als ein Objekt außerhalb unserer selbst anzusiedeln. Sie erscheint als erratischer Block: eben als die Musik. In diesem Objekt - als dem uns nicht mehr Innewohnendem, sondern Gegenüberstehenden - glauben wir dann das zu finden, was wir an Schönem, Edlem und Gutem im Alltag nicht verwirklichen können. So wird Musik zum externalisierten Selbst-Ideal, dem wir uns dann zu unterwerfen haben, indem wir uns z. B. als ausübende Musiker einem bestimmten Aufführungsideal nähern oder als Hörer dem Adornoschen Ideal des „strukturellen Hörens". Zugleich aber entbindet uns das so „feiertäglich Ausgegliederte" von der Mühe der Selbstverwandlung in Richtung unserer Ideale. Die idealisierte Geistigkeit der Musik verkehrt sich in ihre Verdinglichung, indem sie nicht mehr Teil unseres (alltäglichen) Lebens ist. Das Ergebnis dieser Spaltung scheint sich mir in dem beliebten Filmmotiv widerzuspiegeln, in dem der Mörder nach getaner Tat klassische Musik auflegt, der Grundstückspekulant am Tage die Schlägertrupps gegen arme Mieter ausschickt und abends am Flügel sitzt und Chopin spielt.
Dem ließe sich von den Erfahrungen der Musiktherapie und der Improvisation als direkter musikalische Kommunikation ausgehend ein Konzept gegenüberstellen, welches Musik als ein Mittel zur Selbstkultivierung und zur Kultivierung unserer Beziehungen versteht. Dabei wäre nicht das Werk und nicht die brillante Aufführung der Mittelpunkt. Dann wäre das Erlernen eines Instrumentes nicht in dem Maße wie es heute der Fall ist zielgerichtet auf den Auftritt - oder das Musikstudium - und all die, die das nicht erreichen, nur der unvermeidliche Rest beim jahrelangen Ausleseprozess der Elite als dem eigentlichen Ziel der Musikausbildung. Dann würde es auch im hohen Alter noch Sinn machen, ein Instrument zu lernen. Dann könnte es auch von Interesse sein, sich damit zu beschäftigen, was eigentlich in all denen vor sich geht, die inzwischen still für sich am Computer sitzen und mit den Musikprogrammen ihre eigene Musik „basteln". Dann wäre Musiktherapie nur ein Spezialfall der „Selbstbehandlung" mit Musik.
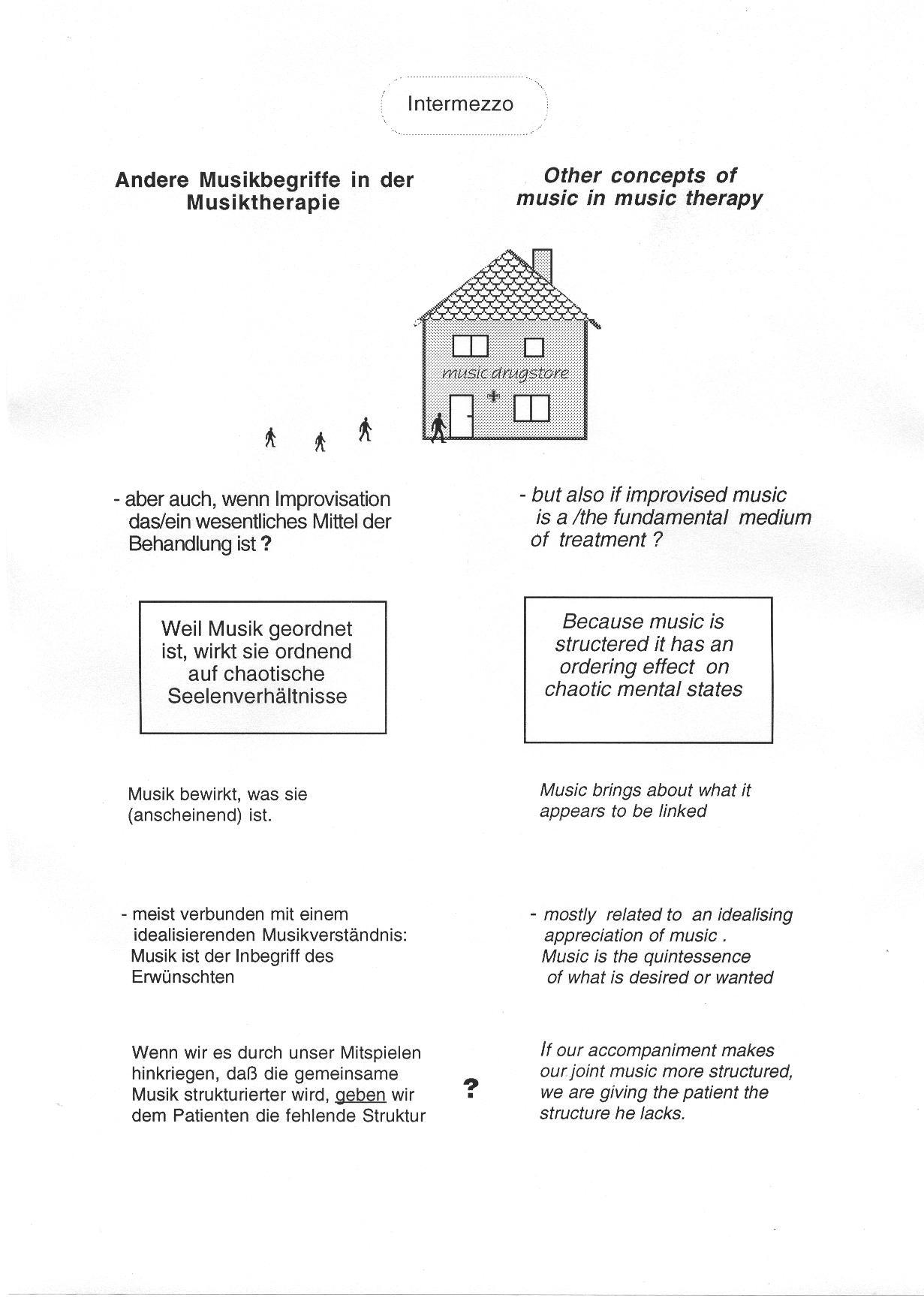
Intermezzo 1: Unterschiede des Musikbegriffs innerhalb der Musiktherapie
Nicht gänzlich vernachlässigen dürfen wir natürlich die Tatsache, dass es auch innerhalb der Musiktherapie unterschiedliche Auffassungen zur Musik gibt. Da ist am einen Ende das Stichwort „Musikapotheke" zu nennen. Auffällig ist allerdings, dass eine solche Praxis der medizinähnlichen Verordnung bestimmter Musik gegen bestimmte Störungen oder Leiden von den meisten MusiktherapeutInnen abgelehnt wird, obwohl - oder gerade weil - diese Vorstellung im öffentlichen Bild von Musiktherapie übermäßig präsent ist. Dennoch gibt es ja auch musiktherapeutische Richtungen, die stärker mit musikalischen Werken arbeiten und in denen dann die Beziehungsarbeit mehr im Verbalen stattfindet oder auch an die Mitbehandelnden delegiert wird.
Aber auch dort, wo die musikalische Improvisation weitgehend im Zentrum des therapeutischen Geschehen steht, unterscheiden sich die Auffassungen. Deutlich ist dies z. B. in der Vorstellung, dass Musik, da sie geordnet ist, ordnend auf Seelenverhältnisse wirkt, die als ungeordnet, chaotisch oder verwirrt angesehen werden. Hier besteht die Vorstellung, dass Musik im Spielenden unmittelbar das bewirkt, was sie ist, bzw. was ihre inneren Strukturen kennzeichnet. Realisiert wird dies innerhalb der improvisatorisch ausgerichteten Musiktherapie etwa in der Vorstellung: Wenn wir als TherapeutInnen durch unser Mitspielen es schaffen, dass die gemeinsame Musik strukturierter wird, dann „geben" wir dem Patienten damit die ihm fehlende Struktur. Eine Vorstellung, die gerade in bezug auf die Arbeit mit Schizophrenen häufig anzutreffen ist. Sie ist nach meiner Erfahrung oft verbunden mit einem idealisierenden Musikverständnis, in dem Musik als der Inbegriff des Erwünschten erlebt wird. (Und mit einer bestimmten Vorstellung von Schizophrenie, die die beeindruckende Strukturierungsleistung negiert, die im Aufbau einer eigenen (Wahn-)Welt auch zu sehen ist.)

Neuere Tendenzen in der Musikwissenschaft
Ich stimme mit Gary Ansdell (1997) überein, dass es auch in der Musikwissenschaft neuere Tendenzen gibt, die über das bisher Gezeigte hinausgehen. (Allerdings bin ich - vielleicht aus deutscher Sicht heraus - nicht ganz so optimistisch wie Gary Ansdell bezüglich der Frage, ob es wirklich berechtigt ist, schon von der neuen Musikwissenschaft zu sprechen, was ja eine gewisse Durchsetzung dieser neueren Strömungen beinhalten würde. Schaut man sich die Lehrstuhlbesetzungen in Deutschland an, so zeichnet sich eine solche Tendenz eher nicht ab.) Ich möchte einige dieser neueren Positionen kurz darstellen.
1. Jobst Fricke, Köln, ursprünglich aus der musikalischen Akustik kommend, vertritt seit einigen Jahren einen Ansatz, den er als systemische Musikwissenschaft charakterisiert. Eines seiner wesentlichen Anliegen ist die Interdisziplinarität, womit auch der weitgehend fehlende Fachaustausch zwischen den verschiedenen Bereichen innerhalb der mit Musik befassten Fachgebiete (z.B. Musikalische Akustik, Musikpsychologie, Historische Musikwissenschaft, Ethnologie, Musikpädagogik und Musiktherapie) gemeint ist. Als Grundsatz und Zentrum seiner systemischen Musikwissenschaft formuliert Fricke (1991, S. 169): „Jede Betrachtung musikalischer Klangproduktionen sollte explizit oder implizit in dem Bewußtsein erfolgen, daß Musik von Menschen für Menschen gemacht wird. Die menschliche Komponente ... ist bei einer systemischen Betrachtungsweise einer Kunstform unerlässlich."
2. Edward W. Said, Jerusalem, New York, wendet sich gegen die Musik als absolutem, vom Sozialen abgetrennten Bereich: „Musik ist einerseits wie die Literatur in ein soziales und kulturelles Umfeld eingebunden, sie ist andererseits aber auch eine Kunst, die ganz wesentlich von der individuellen Vortrags-, Rezeptions- oder Kompositionsweise lebt." (1995, S. 8) Auffällig ist für uns allerdings, dass auch hier improvisierte Musik nicht in den Blick kommt. Dies gilt auch für die Forschungsgebiete, mit denen Said sich beschäftigt. Immerhin aber kommt bei ihm das aktive Musizieren und die subjektive Perspektive in den Blick: „Und ich wage zu behaupten, daß uns letztendlich das Spielen von Musik am meisten befriedigt."
Saids Fokus ist der Zusammenhang zwischen individueller Erfahrung und öffentlichem Bereich. Er liefert in Anknüpfung und Auseinandersetzung mit Dahlhaus und Adorno interessante sozialkritische Analysen. Auch hier steht aber das musikalische Werk im Zentrum und bestimmt den Musikbegriff.
3. Dies ist anders bei Christian Kaden, Dresden, Berlin. Der Musikwissenschaftler Kaden versteht seine Forschungen als musikologische Lebensforschung und beschäftigt sich tatsächlich auch mit musikalischen Formen, in denen Menschen direkt miteinander kommunizieren, so wie wir es auch in der musiktherapeutischen Improvisation kennen. So liefert er z. B. eine eindrucksvolle Analyse eines „singing-crying" der Kalali in Papua-Neuguinea (1993). Musik ist für ihn kein „Nachklang ... des Lebens. Sie stiftet menschliches Miteinander, menschliche Kommunikation, Interaktion. Sie ‘organisiert’ soziales Leben, verleiht ihm Struktur. Und wenn es gut geht ... hilft sie, Leben zu fördern und zu bewahren." Musik wird hier nicht als externalisiertes Werk gesehen, sondern musikalische Form und Leben formen sich aneinander: „Musik gewinnt aus Lebensprozesses ihre Form - und sie gibt dem Lebendigen Form zurück."
4. Gary Ansdell fasst neuere Entwicklungen in der Musikwissenschaft im angelsächsischen Sprachraum zusammen. Die aufschlussreiche Zusammenstellung scheint tatsächlich ein anderes Bild zu zeigen als sich dies im deutschen Sprachraum aufdrängt.
„Die neue Sichtweise (bezogen auf verschiedene Quellen) sieht Musik:
eher als Prozess denn als Struktur
als inniger verbunden mit menschlichem Affekt und Bedeutung
als teilnehmend und von Natur aus sozial
als bestimmt von Kultur und Kontext
als aufgeführt, improvisiert und live ebenso wie notiert und reproduziert
als persönlich, verkörpert (leiblich) und zutiefst menschlich."
(1997, S. 37, Übersetzung RT)
5. Aus dem Artikel von Ansdell soll noch ein weiterer Autor hervorgehoben werden. Lawrence (Richard?) Kramer, so Ansdell, kritisiert die Musikwissenschaft für ihre zu starke rationale Herangehensweise, die Neigung zur generalisierten wissenschaftlichen Erklärung und eine unangemessene Subjekt-Objekt-Spaltung. Von der Position der Postmoderne aus betont er für die Musik die Beziehung gegenüber dem eigenständigen Seinscharakter sowie das Primat von Sinn und Bedeutung. Wie Fricke spricht er sich für einen interdisziplinären Ansatz aus und sieht Musik eingebunden in das gesamte Feld des kulturellen und sozialen Lebens (nach Ansdell 1997, S. 39).



Dennoch erscheint mir die musikwissenschaftliche Forschung bis auf Ausnahmen von den Fragen, die uns in der Musiktherapie von außerhalb unseres eigenen Fachgebietes weiter bringen könnten doch sehr weit entfernt. Auf der Tagesordnung des Forschungsinteresses steht weitgehend das notierte musikalische Werk, „tote Musik""Footnote 08, die musikalische Struktur „an sich" und die mitteleuropäische Klassik (im Sinne des zusammenfassenden Sprachgebrauchs, also inklusive Barock, Romantik, Neue Musik ...). Letzteres wiederum stützt die Fixierung auf die Gleichsetzung von Musik mit dem autonomen musikalischen Werk ab, da es sonst auffallen müsste, dass wir, um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, etwa mit der klassischen indischen Musik eine musikalische Hochkultur kennen, die in ihrem Formenreichtum, ihrer Bedeutung und ihrer zeitlichen Kontinuität der europäischen Musik wohl kaum nachsteht, und die erstens eine improvisierte Musik ist und zweitens ausschließlich mündlich überliefert wird. Wenn sich der Eurozentrismus in der Musikwissenschaft lichten würde, wären hier Forschungen möglich, die notwendigerweise auch den auf das Werk zentrierten Musikbegriff relativieren müssten und ihn stattdessen vermutlich als eine zeit- und kulturbedingte Spezialerscheinung erkennbar werden ließen.
Was ich sonst noch weitgehend vermisse vonseiten der Musikwissenschaft sind Forschungen zu musikalischen Situationen wie dem Üben, dem Erlernen eines Instrumentes, Erscheinungen wie dem Karaoke etc. sowie eine wirklich psycho-logische Herangehensweise an die Phänomene des Musikerlebens.


Intermezzo 2: Affirmativer und kritischer Musikbegriff heute
Die Rede vom affirmativen Musikbegriff oder von einer „affirmativen Musikkultur" setzt implizit immer ein Unbehagen an der Kultur voraus. Es setzt voraus, dass der, der so redet, der Meinung ist, dass an den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse etwas zu kritisieren sei. Es unterstellt, dass es so, wie es zur Zeit läuft, nicht weiterlaufen sollte und geht davon aus, dass ein Künstler, eine Musikerin, ein Musiktherapeut daran (auch) mit der Musik etwas ändern möchte. Oder er impliziert - dialektischer gedacht - dass notwendigerweise jede Gesellschaft ihre Widersprüche hat und dass Kunst entweder die Funktion haben kann, diese Widersprüche im schönen Schein zu verbergen oder sie gewahr werden oder spürbar werden zu lassen. Wer mit seiner Musik die bestehenden Verhältnisse bejaht oder keine Widersprüche spürt, macht sich für gewöhnlich keine Gedanken über diese Unterscheidung. Da die Kultur und die gesellschaftlichen Verhältnisse sich wandeln, ist notwendigerweise ebenfalls für jede Zeit (und in verschiedenen gesellschaftlichen Verhältnissen unterschiedlich) zu definieren, wie wir den Bezug zwischen Musik(begriff) und Gesellschaft ansehen.
Durch die Beschäftigung mit der Frage danach, ob wir im Improvisationsunterricht in der Musiktherapie ein affirmatives oder kritisches Musikverständnis lehren, geriet ich bei der Vorbereitung des Vortrages immer wieder an Fragen, die mich sowieso bedrängen, die aber nur am Rande mit Musiktherapie zu tun (zu) haben (scheinen), und es ist mir nicht wirklich gelungen, diese Differenz zu überbrücken und eine stringente Verbindung herzustellen. Und ich muss zugeben, dass diese allgemeineren Fragen mich schon seit längerer Zeit wesentlich mehr beschäftigen als musiktherapeutische Fachfragen. Ich habe daher während des Symposions meine Fragen nach dem Unbehagen an der Kultur, an den derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnissen, an der politischen Situation in einer sehr persönlichen Art mitgeteilt, ohne jeglichen Anspruch an eine wissenschaftliche Analyse, aber in der Hoffnung, dass die KollegInnen meine Sorgen teilen. Ich habe dazu über einige persönliche Erlebnisse berichtet, an denen sich das, worum es mir geht, jeweils gebrochen hat. Ich habe dies nun auch in der schriftlichen Fassung beibehalten und würde mich auch auf diesem Wege über persönliche Mitteilungen und Beiträge anderer freuen, wie dies auch während des Symposions entstand.
Eine Zentrierung ergab sich für mich durch einen Artikel des derzeitigen (inzwischen damaligen) Rektors „meiner" Universität in einer universitätsinternen Zeitschrift. Mit Stolz schrieb er über die Bemühungen der philosophischen Fakultät um ein moderneres Profil, eine bessere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft etc. und benutzte dabei den Begriff des Humankapitals: Wir, die Universität, die philosophische Fakultät, sind keine Elfenbeinturm, nein, wir sind wertvoll, wichtig, nützlich, denn wir produzieren Humankapital. Das lässt sich verwerten, das kann man verkaufen, das ist für Deutschland ein wichtiges Kapital, das kann man in der Weltwirtschaft (statt Öl, Diamanten oder Kaffee) auf den Markt werfen. „Nein," dachte ich empört, „da mach' ich nicht mit. Das ist nicht meine Universität." Nun gut, der Mann ist Volkswirtschaftler, dachte ich, aber trotzdem: Begriffe reflektieren und schaffen Wirklichkeit und auch wenn es vielleicht Fachbegriffe aus einem anderen Fach sind, muss es erlaubt sein, sie kritisch zu hinterfragen.
Was heißt das: die Universität als Produktionsstätte von Humankapital? Je länger ich darüber nachdachte, desto mehr habe ich mich darüber aufgeregt und desto deutlicher schien mir, dass das kein zufällig gewählter nebensächlicher Gedanke ist, sondern vielleicht wirklich ein Fokus. Footnote 09
Dazu ein kleiner Umweg: Heidegger beklagte, dass unsere Erkenntnismöglichkeiten z.B. des Waldes dadurch verstellt sind, dass der Wald sich in der Moderne aufgelöst hat in Beständlichkeit. Wir sehen nicht (mehr) den Wald, sondern Waldbestände: Wald als zu verkaufendes Holz, als Naherholungsgebiet, als touristische Attraktion ... In der Rede vom Humankapital löst sich der Mensch nun selbst auf in seine Verwertbarkeit, in Kapital, in nutzbaren Mehrwert.Footnote 10 Die Frage nach dem, was ein Mensch ist, impliziert m.E. eine Aufgabe, der sich jede Gesellschaft immer wieder neu stellen muss. Wird diese Frage nicht auf diese Weise endgültig verstellt? Das geht über ein Ausnutzen von Menschen durch andere Menschen auch zu Profitzwecken weit hinaus.
Es scheint mir ein Drehpunkt zu sein, der die Welt endgültig ad absurdum führt. Es ist zu beklagen, dass die Menschen schon lange oder immer schon, das weiß ich nicht, dazu neigten, sich die Welt, das heißt die äußere Natur, untertan, zu Nutze zu machen. Die praktischen Folgen der Naturzerstörung brauche ich hier nicht aufzuzählen. Das hat philosophisch, die Erkenntnismöglichkeiten betreffend, aber eben auch die Folge, wie ich sie mit dem Heidegger-Beispiel angerissen habe, dass nämlich das Sein, das Wesen der Natur sich für uns aufzulösen beginnt in Nutzbarkeit, in Kapital, in Mehrwert. Trotz der unübersehbar zerstörerischen Folgen schickt sich die Menschheit - statt endlich umzukehren - als Steigerung dessen nun auch noch an, sich selbst aufzulösen. Oder praktisch gesprochen: Sollen wir als Lehrende aus den uns anvertrauten Menschen möglichst reibungslos verwertbares Humankapital machen? Nicht für die Studierenden, ihre Bedürfnisse, ihre Sehnsüchte, ihre Ziele, ihre Lebensmöglichkeiten, ihre Verwirklichung sollen wir da sein? Nicht der Förderung ihrer Freiheit als Menschen sollen wir uns widmen, sondern, falls sie noch als halbwegs freie Wesen in die Universität hineinkommen, sie als nutzbare Sklaven des Marktes entlassen? Denn, wenn es eine solche Sicht auf den Menschen schon einmal gegeben hat, dann jeweils zu Zeiten und im Zusammenhang der Sklaverei oder im Feudalismus, wenn z. B. Fürsten ihre „Landeskinder" bei Geldnot an fremde Armeen verkauften.

Die Steigerung ins Absurde besteht allerdings darin, dass bisher wohl kaum eine Kultur vor uns blöde genug war, ein Programm zu entwickeln, mit dem ausgerechnet die eigenen Söhne und Töchter, und noch dazu die jeweilige intellektuelle Elite, zu Sklaven gemacht wurden. Ohne daran etwas beschönigen zu wollen: In den vergangenen Formen der Sklaverei waren immerhin die einen Menschen anderen Menschen als Sklaven unterstellt. Das ist zwar böse, machte aber noch einen gewissen Sinn - zumindest für die einen. Und für die anderen wurde ein Ziel möglich: Entweder selbst vom Sklaven zum Sklavenhalter zu avancieren oder die Sklaverei für alle abzuschaffen. Mit der Rede vom Humankapital gehen wir einen Schritt weiter: Wir schicken uns an, uns selbst, als Mensch an sich, dem Markt zu unterstellen.
Das führt notwendigerweise zu der Frage: Was ist das, der Markt? Hat er eine eigene Existenz ohne uns Menschen? Mit dem Begriff Humankapital verkehrt sich etwas ins Absurde: Der Mensch bringt sich selbst auf den Markt, verkauft sich selbst. Aber an wen? An den Markt? Das heißt, an etwas, was er einst selbst geschaffen hat (um sich zu erhalten), an etwas, was ohne ihn nicht ist. Der Markt, dem das moderne Universitätsmanagement sich stellen zu müssen glaubt, ist so gesehen ein Phantom. Der Markt hat ohne den Menschen kein Sein. Wenn also der Mensch sein Sein an etwas veräußert, was ohne ihn nicht ist, löst er sich selbst auf.
Nun ein weiterer Gedanke: Wenn die einen Humankapital sind, und wir berechnen, was sie kosten und was sie „ihrem Land" einbringen, was ist dann mit denen, aus denen ein Land, eine Gesellschaft kein Kapital schlagen kann? Was sind sie dann? Ein Kostenfaktor, den wir uns in guten Zeiten vielleicht leisten können? Und was ist in schlechten Zeiten? Was wäre, wenn das Geld einmal wirklich knapper würde? Wenn die einen Humankapital sind, werden die anderen dann Ballastexistenzen?
Beim Mittagessen hörte ich kürzlich einem Gespräch zweier Soziologen oder Politologen zu, die klug und engagiert an einem Vortrag zur Problematik der Arbeitslosigkeit arbeiteten. Neben anderem ging es auch um das Erleben der Arbeitslosen, darum dass die sich überflüssig fühlten (was sie oft auch krank mache, was dann auch wieder Kosten verursache) - und dann kam - eher geflüstert: „Und das Problem ist - objektiv gesehen - sie sind es ja auch."
Das brachte mich erneut ins Grübeln. Was ist das Bezugssystem, von dem aus, Menschen überflüssig sind? Es muss eines sein, welches diesen beiden, durchaus nicht zynischen, sondern engagiert wirkenden Kollegen immerhin so selbstverständlich ist, das es ihnen als das Objektive schlechthin erscheint. Auch hier wird wieder deutlich, dass wir uns an einem fatalen Drehpunkt befinden und dass der Mensch dem Markt unterstellt ist. Während in der Ökologiebewegung die übliche Nutzen/Schaden-Verrechnung von Tieren und Pflanzen in die Kritik geraten ist - als anthropozentrisch und insofern der Natur keine eigene Seinsberechtigung zubilligend - sind wir munter dabei, diese auf den Menschen selbst anzuwenden und uns damit uns unsere Seinsberechtigung selbst abzusprechen.
Indem ich hierbei von „wir uns selbst" spreche, mache ich unwillkürlich eine andere Drehung, indem ich davon ausgehe, dass es entweder eine Seinsberechtigung gibt, die sich auf das Menschsein als solches und an und für sich bezieht oder keine. Diejenigen, die das Bezugssystem der Kosten/Nutzen-Rechnung vertreten, scheinen hingegen eher zu hoffen, dass jeweils sie selbst verschont bleiben. Aber schon in der Angst, selbst einmal herauszufallen aus dem Verdikt der Verwertbarkeit, sind sie davon betroffen. Durch diese Angst richtet sich diese Sichtweise gegen die Freiheit des Menschen - und zwar die Freiheit aller.
Für den Fall, dass Ihnen das alles etwas übertrieben vorkommt, noch einige Beispiele: Vor einigen Monaten gab es einen kleinen Skandal bei der Arbeitslosenstatistik, der dann aber wieder unter den Teppich gekehrt wurde. Es war nämlich aufgefallen, dass man bei der monatlichen Statistik all die nicht mitgerechnet hatte, die gerade krank waren, da die ja nicht der Vermittlung zur Verfügung stünden. Auch alle über 56-jährigen hatte man „herausgerechnet", da sie erwartungsgemäß sowieso nicht mehr zu vermitteln seien. Hätte man die beiden Gruppen mitgezählt, wäre die politisch unverträgliche Grenze von 5.000.000 weit überschritten gewesen, während es so „nur" rund 4.600.000 waren. Was heißt das? Auslöschung? Selbst in der sowieso unerträglichen Reduzierung auf eine Zahl in der Statistik!?Footnote 11
Von einem Kollegen erfuhr ich, dass die Suchtkliniken auch deshalb einen Mangel an PatientInnen haben, weil sich für die über 50-jährige AlkoholikerInnen keine Finanzierung der Behandlung als Rehabilitation mehr durchsetzen lässt. Begründet wird dies damit, dass diese Menschen ja erfahrungsgemäß sowieso nicht mehr in den Arbeitsprozess rückführbar sind. Was heißt das anderes als: Sollen sie sich doch totsaufen, das ist billiger. Und wenn wir das weiterdenken, fragt man sich natürlich überhaupt, warum Geld dafür ausgegeben werden sollte, Kranke wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen, wo da doch sowieso schon zu viele sind (s.o.).
Sind wir zu viele?Footnote 12 Das stimmt natürlich nicht ganz, denn platt gesagt, braucht der Markt ja auch Konsumenten. Aber wie ist das mit dem Gleichgewicht der Kosten dafür, dass wir Menschen leben lassen, damit sie als Konsumenten den Markt erhalten? Noch scheint es eine Schamgrenze zu geben. Deshalb wird dieses Denken auch zunächst an einer Gruppe wie den Alkoholikern ausprobiert. Ihre Anerkennung als Kranke ist noch relativ neu und sie scheinen sich für den Test, ob es Empörung geben wird oder nicht, besonders gut zu eignen, weil man sich darauf verlassen kann, dass viele denken werden, die sind doch selber schuld.
Aber es gibt auch in anderen Bereichen deutliche Anzeichen, wenn auch etwas schwerer zu erkennen. In der Alzheimer-Gesellschaft ist derzeit Unruhe ausgebrochen, weil Prof. Dr. Bruder sich in seiner Funktion als Vorstandsmitglied und im Namen von 600.000 Alzheimerkranken und ihrer Angehörigen für die Unterzeichnung der sogenannten Bioethik-Konvention ausgesprochen hat. Warum ist das ein Skandal? In dieser Konvention - und übrigens auch in Bruders Texten - wird das Interesse der medizinischen Forschung über das Recht der Unverletzlichkeit und Würde des Menschen, in diesem Fall „nicht-einwilligungsfähiger Personen", gestellt. Denn es wäre dann erlaubt, sogenannte „fremdnützige Forschung" an geistig Behinderten, dementen, altersverwirrten und psychisch Kranken, die alle ihre Einwilligung nun einmal nicht mehr geben und sich dem nicht verweigern können, durchzuführen. Fremdnützige Forschung heißt: medizinische Experimente, die für den Betroffenen selbst keinen therapeutischen Nutzen haben, sondern lediglich „dem medizinischen Fortschritt" nutzen (bzw. dem, was wer auch immer als solchen definiert). Natürlich liest man in den entsprechenden Begründungen nichts von den Karriereinteressen der Mediziner, die das vertreten, sondern das Leid z.B. der Alzheimerkranken und ihrer Angehörigen wird geschickt in Szene gesetzt und dann mit dem Interesse zukünftiger Generationen an der Verhinderung solcher Krankheiten argumentiert.
Was heißt das anderes als die Auffassung zu vertreten, dass in einem makaberen Generationenvertrag die derzeit lebenden Kranken, wenn sie denn schon so viele Kosten verursachen, sich doch wenigstens als Forschungsleiber nützlich machen können. Das wird auch darin deutlich, dass es nur scheinbar einschränkend heißt, dass auf diese Personengruppe nur dann zurückgegriffen werden soll, wenn sich keine anderen freiwilligen Versuchspersonen finden lassen. Was werden das für Versuche sein? Ein Skandal aus Schweden lässt Böses ahnen: Wer anderes als nichteinwilligungsfähige geistig Behinderte, wäre bereit gewesen, sich monatelang mit Süßigkeiten voll stopfen zu lassen, um auszutesten, wie Karies entsteht und wie sie sich unbehandelt weiterentwickelt?Footnote 13
Ein neuer Musikbegriff?
Zurück zur Frage danach, welchen Musikbegriff wir in der Musiktherapie und speziell in der (Lehre der) musiktherapeutischen Improvisation vertreten. Mit der musikalischen Improvisation, wie wir sie in musiktherapeutischen Studiengängen lehrenFootnote 14 vertreten wir eine Musikausübung, die Musik als direkte Kommunikation zwischen Menschen in den Mittelpunkt rückt. Wir lehren Musik als Beziehungsgestaltung zwischen (zeitlich und räumlich anwesenden) Menschen und als (oft unbewusst bleibende) Mit-Teilung von Empfindung und Selbst- und Welterleben. Wir lehren Musik als Prozess und Ereignis, auch wenn die Studierenden an anderer Stelle auch ihren Produktcharakter kennen lernen (z. B. bei der nachträglichen Analyse musiktherapeutischer oder anderer Improvisationen). Die Studierenden erfahren Musik als seelischen Ausdruck, als Reflexion seelischer Verhältnisse und zugleich als Mit- und Neugestalterin dieser Verhältnisse.
Sie lernen Musik kennen (in der Lehrmusiktherapie, den Praktika, den Fallbeispielen) als ein Medium, dessen sich das Seelische unvoreingenommen bedient, um „Geschichten über das Leben zu erzählen", die es in Sprache nicht erzählen kann, die dennoch Geschichte geworden sind im Sinne der weiterhin wirksamen verinnerlichten, also gegenwärtigen Vergangenheit. Und sie können erfahren, wie sich die aus Beziehungen stammenden Strukturen in der musikalischen Beziehung zum einen niederschlagen und sie als TherapeutInnen mit hineinziehen in das Erleben des anderen, aber auch, dass es möglich ist, innerhalb der musikalischen Beziehung neue Erfahrungen zu machen, die zu einer umwandelnden Verinnerlichung werden können. Im Improvisationsunterricht wie in der Supervision nutzen wir Musik darüber hinaus als Erkenntnismittel, z. B. indem wir psychologische Verhältnisse und Fragestellungen musikalisch mit Hilfe des Improvisierens ausloten (vgl. Tüpker 1996 und 1998).
Die Musiktherapie hat damit einen eigenen Musikbegriff ausgeprägt, den weiter herauszuarbeiten sich sicherlich lohnen würde. Er birgt m. E. ein kritisches Potential, welches sich der Tendenz der Verwertungsgesellschaft entgegenstellt.Footnote 15 Er könnte über den musiktherapeutischen Behandlungsrahmen hinaus auch andere Bereiche des Musiklebens befruchten und der Musikwissenschaft wie auch der Musikpädagogik Impulse geben, die zu einer Bereicherung im Umgang mit Musik führen könnten.
Literatur:
Ansdell, Gary (1997):. What has the New Musicology to say to music therapy? In: British Journal of Music Therapy, Volume 11/2
Bastian, Hans Günther (2000): Musik(erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen. Schott-Verlag, Mainz
Casimir, Torsten (1991): Musikkommunikation und ihre Wirkung. Eine systemtheoretische Kritik. Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden.
Fricke, Jobst (1991): Die Wechselwirkung von Mensch und Instrument im Zusammenspiel von Physik und Psychologie. In: Enders/Hanheide (Hrsg.): Neuere Musiktechnologie. Vorträge und Berichte vom KlangArt-Kongreß 1991 an der Universität Osnabrück
Kaden, Christian (1993): Des Lebens wilder Kreis. Musik im Zivilisationsprozeß. Bärenreiter Kassel
Klöckner, D. (1989): Instrumentalunterricht für Erwachsene. In: Holtmeyer, G. (Hrsg.). Musikalische Erwachsenenbildung. Schott Mainz
Kramer, Lawrence (1995): Classical Music & Postmoderne Knowledge. University of California Press
Luks, Allan; Payne, Peggy (1998): Der Mehrwert des Guten. Wenn Helfen zur heilenden Kraft wird. Herder, Freiburg, 1998
Said, Edward W. (1995): Der wohltemperierte Satz. Musik, Interpretation und Kritik. Carl Hanser Verlag, München/Wien [orig.: Musical Elaborations, Columbia University Press 1991]
Tüpker, Rosemarie (1996a): Supervision als Unterrichtsfach in der musiktherapeutischen Ausbildung. In: Musiktherapeutische Umschau, Band 17/3-4
Tüpker, Rosemarie (1996b): Supervision im Erleben von Studierenden der Musiktherapie. (wie 1996 a, aber mit den genaueren Daten der Fragebogenuntersuchung) Einblicke, Heft 7
Tüpker, Rosemarie (1998): Reflexion seelischer Verhältnisse in der musikalischen Improvisation. In: Lenz/Tüpker: Wege zur musiktherapeutischen Improvisation. LIT-Verlag, Münster 1998
Wolf, Rainer (1986): Zur objektiven Erkenntnis von Musik. Musikwissenschaftliche Dissertation, Freiburg i. Br.