Nanz,
Dieter A. (Hrsg.): Aspekte der freien Improvisation in der Musik.
Hofheim (Wolke Verlag) 2011.
von Carl Bergstroem-Nielsen
Webseite mit Bonusmaterial:
www.getreidesilo.net
Dieser Artikel wurde im Ringgespräch über Gruppenimprovisation LXXVII, April 2014 (S.70-71) veröffentlicht, jedoch ohne die Illustration.
In der Schweiz wurde die freie Improvisation diskutiert. 2003 bis 2010 wurden „Basler Improvisationsmatineen“ arrangiert auf Initiative von Nicolas Rihs und Hansjürgen Wäldele mit Konzerten, kleinen Vorträgen und Diskussionen, auch in noch weiteren Städten.1 Der von Kritiker Thomas Meyers 2010 veröffentlichte Artikel ”Ist die freie Improvisation am Ende?“ provozierte einen Sturm von Kommentaren hervor - nicht weniger als 35 Kommentatoren beschriebten ihren Eindruck von der Szene.2 Kurz nachher erschien dies Buch auf dem Hintergrund der Improvisationsmatineen, mit 33 Beiträgen. Es zeugt von einer Breite in der Diskussion, so decken sich die Namen der Verfasser sich nur ganz wenig mit denen, die auf Meyers Artikel reagierten - die Besucher von Matinees und Leserschaar der Zeitschrift sind nicht dieselben Leute.
Die Diskussion in der Schweiz über freie Improvisation scheint also neuerdings umfassend zu sein, und Improvisation ist bei Musikhochschulen schon etwas etabliert geworden. Das Buch ist Resultat einer Umfrage, die Autoren wurden gebeten, folgende Frage zu beantworten: „Welche Frage muss man stellen, um das Wesentliche der freien Improvisation zu erfahren?“. Nicht nur Musiker, auch Journalisten, Musikwissenschaftler und Komponisten wurden befragt.
Programmatisch erscheint ein Zitat von Miriam Sturzenegger auf der Hinterseite des Buches, das eine Erweiterung der Sprache, das Schaffen von neuen Begriffen, die eine adaequate Beschreibung und Perspektivierung dienen, als wünschenswert sieht.3 Freie Improvisation hatten wir schon lange. Kann der Leser aus dem Buche eine generelle, aktuelle Charakterisierung der freien Improvisation gewinnen? Ich versuche das zu skizzieren im Folgenden - obgleich die Vielfalt der Beiträge, wie man sich denken kann, jenseits möglicher Zusammenfassung sind. Vieles wird für mich als Leser zu einem Hexenkettel von „gemischten Betrachtungen”, worin Teilmomente aufleuchten können. Solches Labyrintische („Mäandernde“ sagt Thomas Meyer) könnte vielleicht auch ein Zeichen sein für das von Sturzenegger formulierte Problem: wie kann man sinnvoll und verständlich über die frei Improvisierte Musik sprechen?
In direktem Zusammenhang mit Spielen oder Hören können viele Beobachtungen und Fragen auftauchen. Meyer bezeichnet die Begriffe „Form”, „Interaktion” und „Verantwortung” als oft verwendete während den Matinees. Urban Mäder präsentiert eine detaillierte Dokumentation aus einer seiner Lehrstunden für freie Ensembleimprovisation an der Musikhochschule Basel. Das kann ein Beispiel dafür sein, wie Dialoge wichtig ist für das Entstehen von Bedeutung. Was aber sehr bedeutungsvoll mitten in einer Diskussion erscheint, könnte in einem anderen Kontekst nicht nur schwer „generalisierbar” sein, sondern einfach weniger erhellend. Das könnte wiederum auch an einer Mangel an Verbindungen zu allgemeinen und gängigen Begriffen liegen.
Einige Autoren kritisieren den Begriff von „Freiheit” und andere solche, die wie dieser mit Emanzipation oder Ähnlichem zu tun haben können. Für Sebastian Kieffer sind „Unvorhersehbarkeit” und „Spontaneität” weder notwendig mit einander verbunden, noch ist Spontanietät ein besonderes Privileg für improvisierte Musik. Claudia Ulla Binder (S.187) beschreibt Letzeres eindringlich: wenn „alle Anwesenden am Entstehen von aufregender Musik teilhaben“, dann gilt zwar, dass „Wer das einmal erlebt hat, will es unbedingt wiedererleben“. Aber: „Nun gibt es aber diese ‚wahnsinnigen’ Momente auch dann, wenn grossartige Interpreten oder Interpretinnen einen riesigen Konzertsaal zum gemeinsamen Atmen oder zum Anhalten desselben bringen…und dies mit komponierten Werken, die vor vielen Jahren zu Papier gebracht wurden“.
Für Matthias Kaul (S.53) existiert Freiheit nur in der Wahl von „Spielmaterialien” (er meint vielleicht Instrumente und Ähnliches?) - sonst herrscht eine Situationsabhängige Disziplin. Für Harald Kimmig (S.138) sind Begriffe wie „Kreativität” und „Intuition” „überstrapaziert” und „missverständlich”. Peter Baumgartner (S.190) ist dagegen, „Mythopoeten des 'Augenblicks', der 'Präsenz', des 'Neuen', etc.” zu sein. Er verweist auf eine vorhersehbare Dimension in Improvisationen und auf konventionelle Züge im Klingendem und in der Interaktion. Rudolf Kelterborn (S.177) sowie Binder (S.186) führen dies weiter aus. Ersterer moniert eine Mangel an „unorganischen” Impulse sowie eine Dominanz von langen allmählichen Entwicklungen; letztere das häufige Auftreten bekannter Texturen: Klangfläche, mit Löchern, mit Höhepunkt. Möglicherweise waren Begriffe wie „Freiheit” etc. relevanter in den sechsziger und siebziger Jahren als jetzt, und es ist jetzt mehr an der Zeit, die freie Improvisation als eine Praxis anzuschauen, welche ihre spezifischen Ansprüche ihren Spielern beauftragen. Das ist wenigstens in negativer Umschreibung zu erkennen. Nanz beschreibt das Sachverhalt mit diesem Metapher: „Die rotglühende musikalische Lava der sechziger Jahre ist abgekühlt, man beginnt, das unwegsame neue Atoll zu vermessen - um es zu besiedeln”4.
Praktische Ratschläge für Musiker könnten vielleicht leichter zu formulieren sein. Walter Faendrich führt eine Zahl von Checklisten an, die auf Vermeidung von Klischees zielen. Und Rohner macht seine Vorschläge wunderbar klar durch grafische Illustrationen.
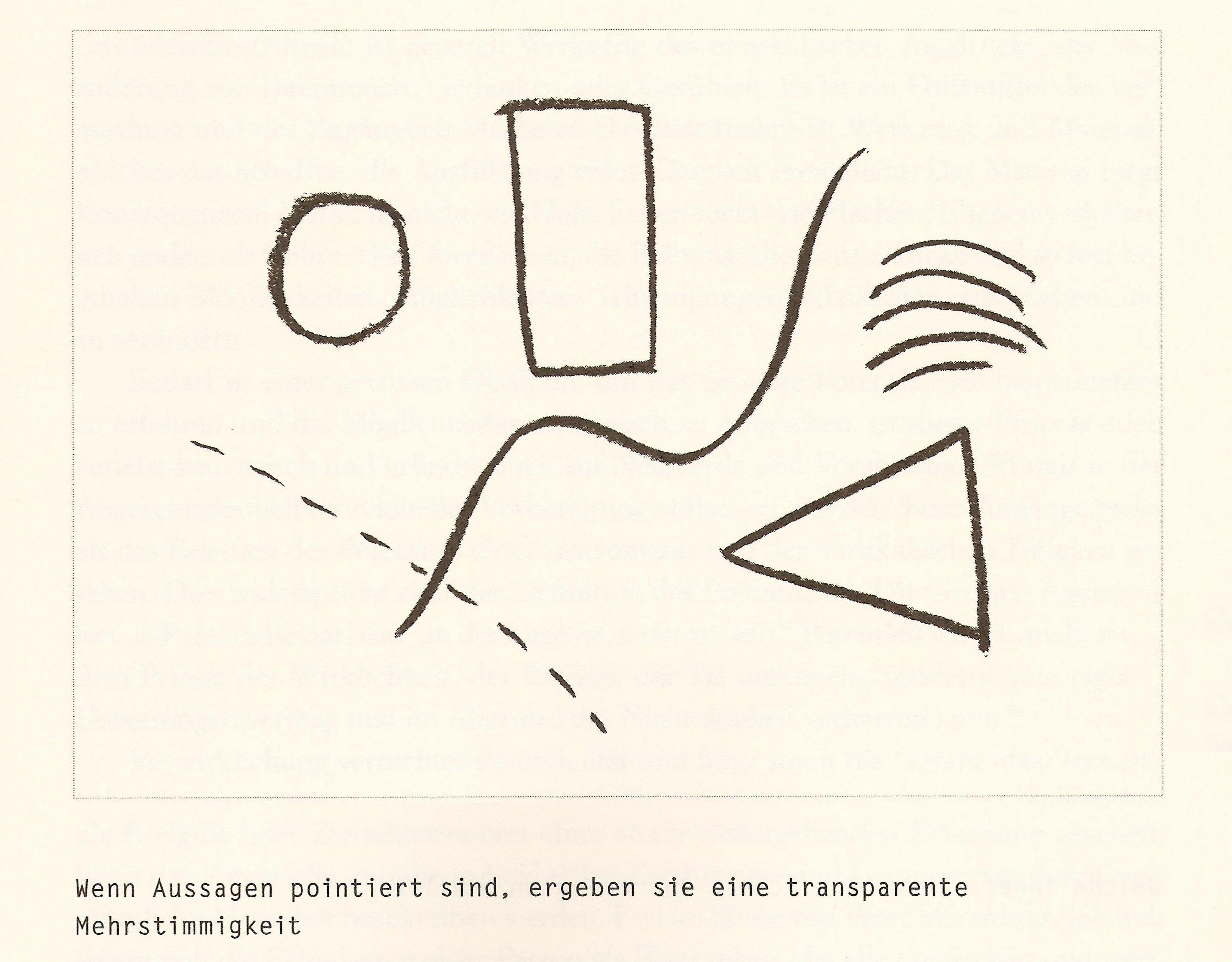
Aus Lukas Rohners Beitrag: "Die Stille ist ein Garten, in dem die wundervollsten Klänge gedeihen", p.105.
Christoph Schiller fasst Charakteristika der Musik zusammen in eine Liste – so eine einfache Systematik hilft schon, über das rhapsodische hinauszukommen. Ein ähnliches Verfahren ist das thematische Register für das ganze Buch vom Redakteur. Und Harald Kimmig demonstriert, dass es doch innerhalb des möglichen liegt, an gemeinsamen Begriffen, in welchen man über die freie Improvisation sprechen kann, zu gelangen. Er stellt fünf Fragen: ”Was geschiet instrumentaltechnisch? Was geschiet ästhetisch? Ist Motorik (Körper), Emotion, Intellekt im Spiel? Wie wird kommuniziert? Ist Bereitschaft zum Risiko vorhanden?”. Sie sind anwendbar auf jede Musik und zielen pragmatisch auf „hard facts”. So könnten sie deskriptiv funktionieren, eine ethnologische/soziologische komparative Perspektive andeuten. Was überwiegt hier, so kann man anhand dieses Modells fragen.
So, zum Beispiel, kommen wir vielleicht aus der „mythopoetischen” Sphäre hinaus und hin zur Aktualität.
***
1 Nanz kommentiert hier: ”Improvisieren und Forschen. Gedanken am Rande der Basler Improvisationsmatineen”. MusikTexte 114, August 2007, S.83-84.
2 Sowohl Meyers Artikel (Dissonanz 110, 2010) als die Reaktionen sind hier im Internet zu sehen: http://www.dissonance.ch/de/rubriken/6/95
3 Kein Quellennachweis im Buche, doch das Zitat scheint ein leicht revidiertes Auszug aus ihrem Text in Antwort zu Meyer zu sein, siehe URL in Note 2.
4 Aus dem in 2007 geschriebenen Artikel S.83, siehe Note 1